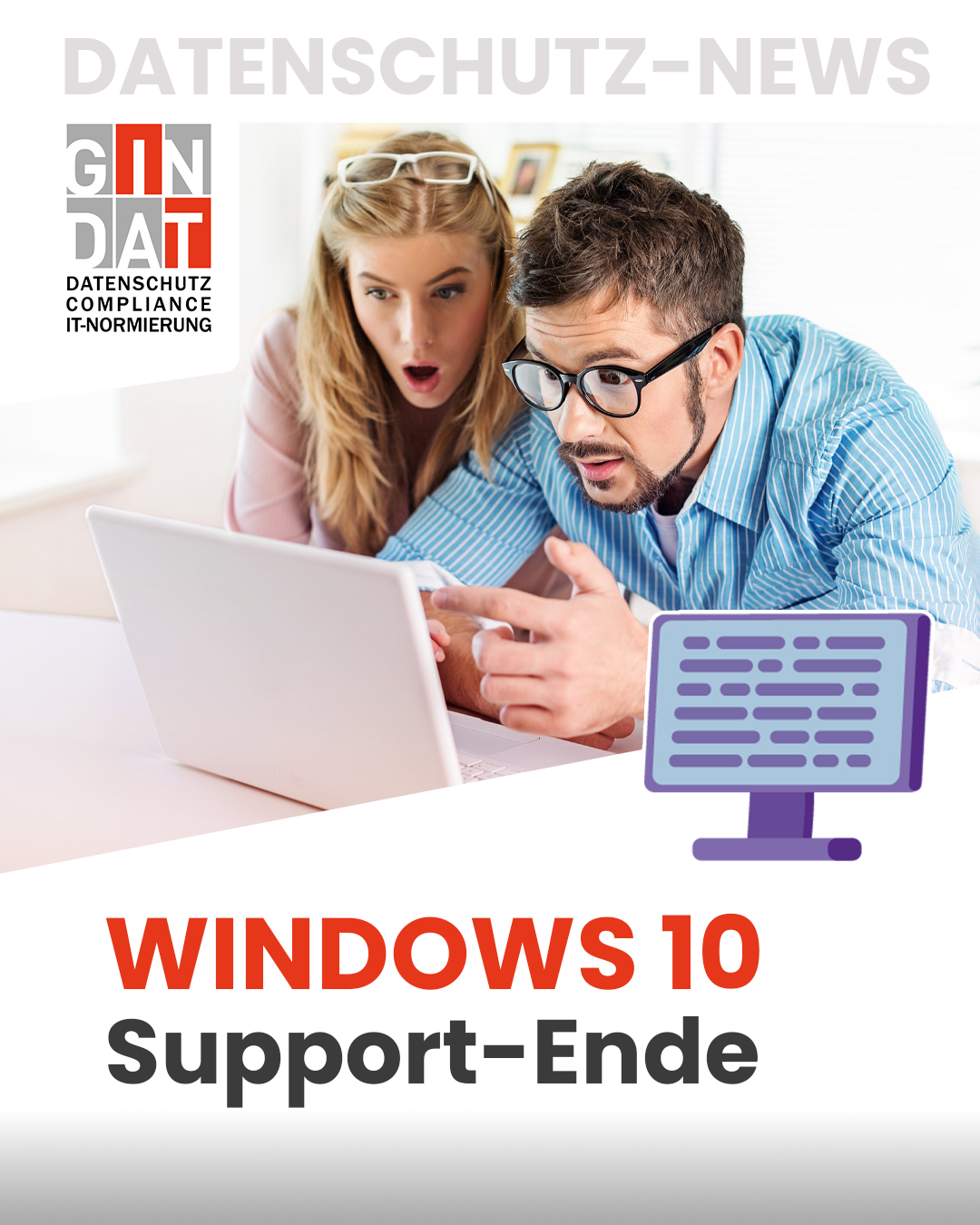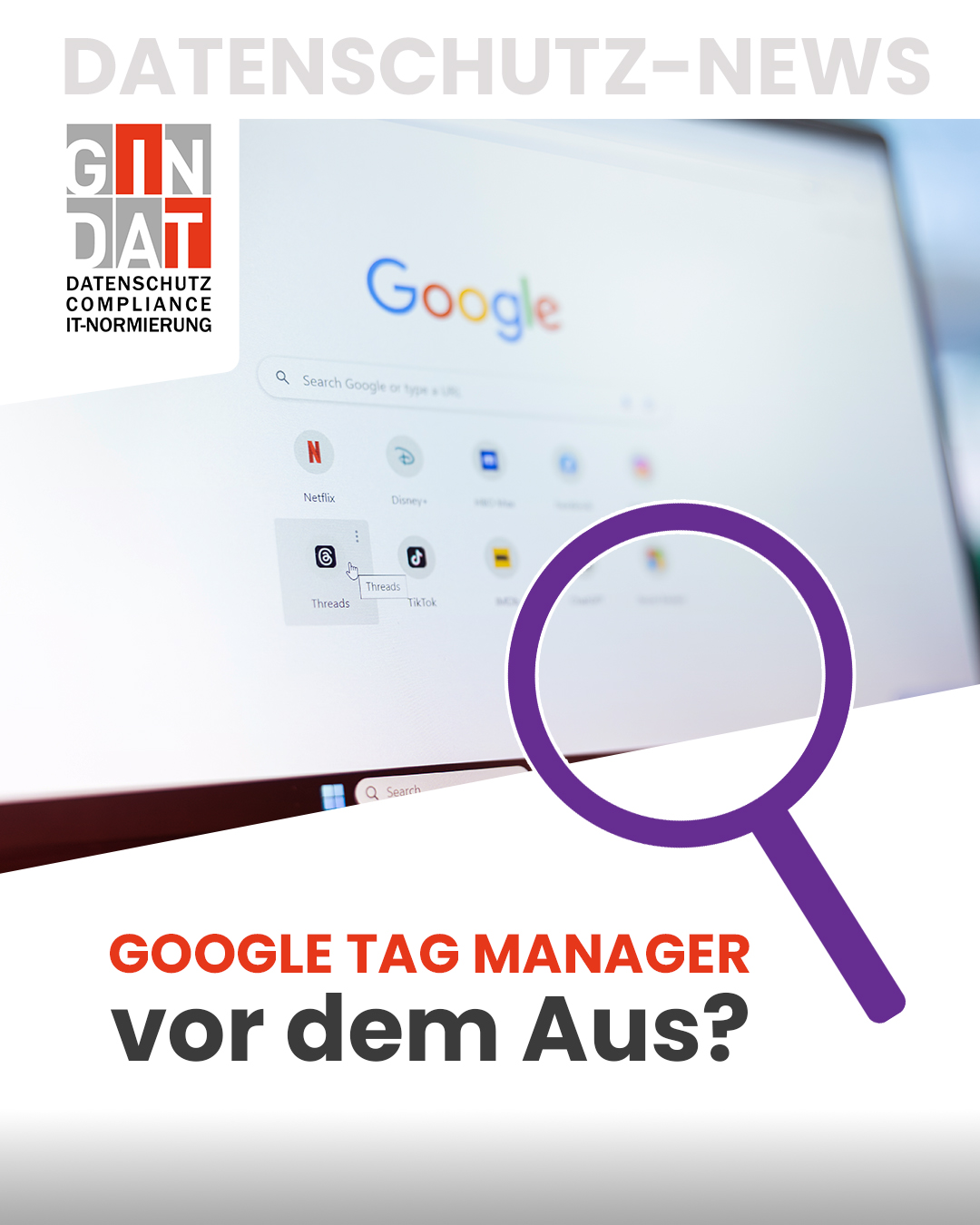Support-Ende für Windows 10: Was Sie jetzt wissen und tun müssen
Die Auswirkungen des bevorstehenden Windows 10-Aus
Am 14. Oktober 2025 ist Schluss: Microsoft beendet den Support für Windows 10. Was bedeutet das konkret? Ab diesem Stichtag erhalten Nutzer weder Sicherheits- noch Funktionsupdates. Das betrifft Millionen Rechner – besonders in Deutschland, wo der Anteil von Windows 10 nach wie vor die Mehrheit der Windows-Installationen ausmacht. Während Windows 11 langsam an Marktanteil gewinnt, nutzen noch immer viele Privatpersonen und Unternehmen die Vorgängerversion.
Das Betriebssystem verliert nach dem Support-Ende seine Stabilität in Sachen Sicherheit. Immer wieder werden neue Schwachstellen entdeckt. Ohne zeitnahe Updates steigt das Risiko für Cyberangriffe schnell und drastisch. Diese Gefahr betrifft insbesondere sensible Firmendaten und kann auch die Betriebsfähigkeit von Unternehmen gefährden. Privatnutzer sind vor Datendiebstahl, Schadsoftware oder Phishing-Versuchen ebenso wenig sicher.
Die aktuelle Bedrohungslage und warum ein Wechsel wichtig ist
Digitale Angriffe nehmen seit einigen Jahren massiv zu. In Deutschland melden laut Branchenverbänden 80% der Unternehmen, dass Cyberattacken spürbar mehr geworden sind. Der damit entstandene Schaden ist enorm und beläuft sich branchenübergreifend auf viele Milliarden Euro. Ohne abgesichertes Betriebssystem kann es schnell zu erheblichen finanziellen und reputativen Verlusten kommen.
Die Entwicklung ist nicht nur auf den Wirtschaftssektor beschränkt. Auch Privatpersonen können Opfer von Datenklau oder Erpressungstrojanern werden. Deshalb gilt: Sobald für ein System keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden, ist dessen Nutzung ein erhebliches Risiko – unabhängig von der Branche oder Nutzungssituation.
So reagieren Sie richtig auf das Support-Ende von Windows 10
Ihre Handlungsoptionen im Überblick
Wenn der Support endet, besteht akuter Handlungsbedarf. Grundsätzlich gibt es vier sinnvolle Wege, auf die neue Situation zu reagieren:
- Ignorieren: Davon ist dringend abzuraten. Ohne Updates können neu gefundene Schwachstellen nicht geschlossen werden. Die Nutzung eines veralteten Systems empfiehlt auch keine Sicherheitsbehörde mehr.
- Supportverlängerung: Für Unternehmen und Privatpersonen besteht die Möglichkeit, die Sicherheitspatches über das sogenannte „Extended Security Update“-Programm (ESU) kostenpflichtig weiter zu bekommen. Unternehmen können sich sogar bis zu drei Jahre zusätzliche Updates sichern – allerdings steigen die Kosten jährlich deutlich an. Für Privatleute gibt es günstigere oder kostenlose Varianten für ein weiteres Jahr – langfristig ist das aber keine Lösung.
- Umstieg auf ein alternatives Betriebssystem: Speziell für Privatpersonen und kleine Unternehmen, deren Hardware nicht mit Windows 11 kompatibel ist oder die unabhängig von Microsoft werden möchten, kann Linux eine interessante Alternative sein. Moderne Linux-Distributionen bieten eine benutzerfreundliche Oberfläche und unterstützen gängige Alltagsanwendungen. Allerdings ist eine gewisse Bereitschaft zum Umdenken erforderlich, da einige Programme (z. B. Microsoft Office) nicht lauffähig sind. Unternehmen müssen zudem abwägen, ob die eigene IT-Infrastruktur und die Mitarbeitenden auf ein neues System umgestellt werden können.
- Umstieg auf Windows 11: Wer weiterhin im Windows-Ökosystem bleiben möchte, sollte prüfen, ob die Hardware kompatibel ist. Wichtig ist hier vor allem das Vorhandensein eines TPM 2.0-Moduls und eines unterstützten Prozessors. Vor dem Wechsel sollten unbedingt alle Daten gesichert werden, um Datenverlust zu vermeiden. In manchen Fällen kann es auch sinnvoll sein, eine vollständige Sicherung („Backup“) des bisherigen Systems zu erstellen.
Worauf Sie beim Umstieg achten sollten
Der Wechsel des Betriebssystems ist ein sinnvoller Anlass, die eigene Hardware und Software auf den Prüfstand zu stellen. Ist die bisherige Ausstattung noch leistungsfähig genug für neue Anforderungen? Können alle wichtigen Programme weiterhin genutzt werden? Gibt es für kritische Software, die auf Windows angewiesen ist, Alternativen unter Linux? Vor allem Unternehmen sollten überlegen, wie tief sie ins Microsoft-Ökosystem eingebunden sind und ob ein Wechsel technisch und organisatorisch machbar sowie wirtschaftlich sinnvoll ist.
Wer sich für den Umstieg auf Linux entscheidet, profitiert von Vorteilen wie dem Wegfall von Lizenzkosten, mehr Datenschutz und weniger Herstellerabhängigkeit. Allerdings müssen auch die Kompetenzen im IT-Team entsprechend vorhanden sein – oder es muss externe Unterstützung eingeholt werden.
Entscheiden Sie sich für Windows 11, prüfen Sie, ob Ihre Geräte alle Voraussetzungen erfüllen. Ansonsten ist zu klären, ob eine neue Hardware angeschafft wird oder der Wechsel zu einer Alternative sinnvoller ist.
Ganz gleich, für welchen Weg Sie sich entscheiden: Eine sorgfältige Datensicherung sollte immer an erster Stelle stehen! Verlieren Sie nicht aus den Augen, dass die Umstellung nicht nur ein technisches, sondern auch ein organisatorisches Projekt ist, das frühzeitig geplant und umgesetzt werden sollte.
Zeitnah handeln – Ihre nächsten Schritte für eine sichere IT
Warum Sie nicht zögern sollten
Das Support-Ende von Windows 10 ist kein Ereignis, das man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Nicht selten wird die Umsetzung verschoben – mit dem Risiko, später zeitlich und organisatorisch unter Druck zu geraten. Jede Organisation, aber auch jeder Privatanwender sollte frühzeitig eine Entscheidung treffen, wie mit dem Ende von Windows 10 umgegangen werden soll.
Dabei geht es nicht nur um IT-Fachfragen, sondern um die Sicherheit sensibler Daten, um einen zuverlässigen Geschäftsbetrieb und, im Zweifelsfall, um die Existenzgrundlage von Unternehmen. Wer zu lange wartet, läuft Gefahr, ungesichert in die Support-Lücke zu geraten.
Ihr Fahrplan für einen reibungslosen Übergang
Nutzen Sie die verbleibende Zeit und gehen Sie die Umstellung strukturiert an:
- Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre aktuelle IT-Landschaft. Welche Endgeräte sind betroffen? Welche Software wird genutzt?
- Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Geräte für Windows 11 oder Alternativen wie Linux.
- Erstellen Sie ein Migrationskonzept, das Ihre individuellen Anforderungen abdeckt.
- Planen Sie gezielte Datensicherungen für alle wichtigen Dateien.
- Schulen Sie Ihre Nutzer bzw. Mitarbeitenden rechtzeitig für das neue System.
- Holen Sie sich bei Bedarf professionelle Unterstützung, gerade wenn sich Ihre IT-Landschaft als komplex erweist.
Fazit: Lassen Sie sich nicht überraschen, sondern handeln Sie jetzt. Wer frühzeitig plant, kann mögliche Risiken minimieren und sicher in die Zukunft starten.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung oder Umsetzung Ihrer Systemumstellung? Kontaktieren Sie uns gerne – wir helfen Ihnen dabei, die beste und sicherste Lösung für Ihren individuellen Bedarf zu finden.